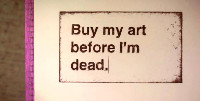Hier der Artikel von Helge Sobik aus dem Deutschen Ärzteblatt:
Golf von Biskaya: Die Urgewalt der Zeiten
Die Stürme fühlen, ihr Heulen hören – immer mehr Menschen zieht es im Winter zum „Stormwatching“ an die Küsten von Kantabrien und Asturien.
.

Der Wind rupft an den Halmen auf den Dünen von Liencres, als wolle er an diesem Vormittag allen Strandhafer auf einmal umpflanzen. Er faucht durch das Pinienwäldchen, das die Sandhügel festhält. Ein paar Strandspaziergänger stemmen sich mit aller Kraft gegen den Wind. Seit Stunden schon führt er sein expressives Wellenballett an der Küste von Kantabrien auf und schlägt den Golf von Biskaya schaumig. Immer neue Atlantikbrecher schieben sich Richtung nordspanische Küste heran, zerbersten an vorgelagerten Klippen, rollen auf dem festen, goldenen Sand aus. Auch Töne gehören zu dem winterlichen Spektakel: das Geräusch eines vorbeirasenden Zuges, eines gewaltigen Wasserfalls, einer Grundschulklasse beim Pausenklingeln. Wind und Wellen versuchen sich als Stimmenimitatoren – kein Zug weit und breit, kein Wasserfall, keine Schulkinder.
In den Wintermonaten stürmt es häufig und heftig an der spanischen Nordküste mit ihren Klippen, ihren herrlichen Stränden, die viel länger und breiter und schöner sind als die meisten am Mittelmeer. Viel kürzer ist die Saison hier, nur Juli und August. Kaum Ausländer sind dabei, fast nur Spanier. Aber neuerdings kommen ausgerechnet im Winter immer mehr Fremde und machen etwas, was sonst nur an Kanadas wilder Pazifikküste bekannt war: Sie reisen zum „Stormwatching“ an, nisten sich in kleinen Hotels ganz oben auf den Klippen, ganz vorne an den Strandpromenaden ein, um die Unwetter hautnah zu erleben.
José Domingo Lécue kennt sich gut aus mit den Stürmen. Sie sind sein Beruf. Er ist seit 17 Jahren bei den Patronas de la Salvamar dabei, den Seenotrettern. Inzwischen ist er Kapitän des Rettungskreuzers der kantabrischen Hauptstadt Santander. Bei Wetter wie diesem ist er in Alarmbereitschaft und ständig abfahrbereit. Seekrank ist Lécue nur ein einziges Mal gewesen, Biskaya hin oder her: „Als Kind auf einem Fischkutter. Nicht wegen der Wellen, sondern weil es so nach Schiffsdiesel stank.“ Er lacht. „Ich habe 14-mal am Tag gekotzt.“ Jetzt lacht er noch lauter. „Aber ich habe an dem einen Tag auch 14-mal gegessen.“
In dieser Nacht fängt der weiter erstarkende Wind zu heulen an. Durch alle Ritzen des alten Hotels auf den Klippen von Suances pfeift er. Zwölf Stunden geht das so. Es klingt wie die Begleitmusik zum Untergang der Welt. Der Sturm rüttelt am verglasten Balkon. Die großen Scheiben wölben sich unter dem Druck – und halten am Ende stand. Seeschwalben reiten davor den Wind aus, hängen im stärksten Sturm reglos über der Playa de los Locos in der Luft. Irgendwann stürzen sie sich senkrecht in die Tiefe, um sich knapp über der Wasseroberfläche von einer Bö wieder auffangen zu lassen und weiter zu reiten.
Bald darauf ist der Sturm mit einem Schlag vorbei. Als ob die Wellen einfach abgeschaltet wurden. Auch die Menschen kommen wieder hervor, und vor mancher Sidreria, mancher Bar an der kantabrischen wie der westlich anschließenden asturischen Küste stehen plötzlich wieder Tische und Stühle im Freien. Noch vor einer Stunde hätte der Wind sie davongetragen. Angler reihen sich an der Mole von Ribadesella auf, plaudern wie fast immer von Prinzessin Letizia, Ehefrau von Spaniens Kronprinz Felipe, deren Großmutter in Ribadesella wohnt und die häufig hier zu Besuch ist. Fischer Vicente Peñil Montes flickt derweil an Land die Netze. Am nächsten Morgen um fünf wird er, so sich die Wettervorhersage als richtig erweist, wieder hinausfahren: „Nach solchen Stürmen stehen die Chancen besonders gut, mit reichlich Lubinas, den Wolfsbarschen, zurückzukommen.“
Enrique Luzuriaga hat diese Stürme immer geliebt, ist dann 112 Steinstufen nach oben gestiegen, um alle Urgewalt aus nächster Nähe zu erleben: Er war der Leuchtturmwärter von Santander – der letzte, bevor die Anlage automatisiert und das einstige Wärterhaus in ein Museum verwandelt wurde. Wo einst Enriques Wohnzimmersofa stand, sind heute Vitrinen aufgestellt, darum herum Gemälde aufgehängt. Es gefällt ihm gut, dreht sich um Leuchttürme und ihre Wärter. Ob es etwas gibt, was ihm noch besser gefiele? „Wenn mein Sofa noch da stünde, das gefiele mir besser“, sagt er mit ein bisschen Wehmut in der Stimme. Einen Schlüssel zum Turm hat er noch, und wenn es richtig stürmt, steigt er noch manchmal auf die Plattform hinauf wie früher – oder fährt zum Strand von Liencres und hockt sich vor die Dünen. Zum Stormwatching, zur observación de tormentos. „Und um die Stürme zu fühlen“, sagt er. „Du spürst die Macht der Natur, die Urgewalt der Zeiten. Das pustet den Kopf frei, lädt dich auf, ist spannender als ein Fernsehkrimi, besser sogar als das Sofa.“ Er lächelt. Und hält den Kopf in den Wind. Helge Sobik